Duchamp in München
14. Juni 2012 / Eingestellt von thw um 08:33 /
Die Ausstellung 'Duchamp in München' ist sehr gelungen. Anbei ein Text dazu:
Hugo Boadas
Duchamp in München
Zur Ausstellung im Kunstbau der
Städtischen Galerie im Lenbachhau
Zum
hundertjährigen Jahrestag des Besuchs Marcel Duchamps in München widmet ihm die
Städtische Galerie dort eine Gedenkausstellung. “Mein Aufenthalt in München war
der Ort meiner völligen Befreiung…“ Dieser Satz wurde für diese Ausstellung zum
Motto gewählt. Formuliert hat ihn Duchamp in seinem Diavortrag “A propos of myself” 1964 im City Art Museum of St. Louis: „My
stay in Munich was the scene of my complete liberation, when I established the
general plan of a large size work which would occupy me for a long time on
account of all sorts of new technical problems to be worked out.“ (“A propos of
myself” in: Marcel Duchamp, (Hg. Anne d’Harnoncourt u. Kynaston McShine)
Katalog Museum of Modern Art, NY, und Philadelphia Museum of Art, Philadelphia
1973, 263) Die Fortsetzung des Satzes unterstreicht die Bedeutung für
das folgende künstlerische Projekt des Großen
Glases „La mariée mise à nu par ses célibataires, même“.
Die Münchener
Ausstellung versammelt alle sechs bekannten Arbeiten, die Duchamp während
seines hunderttägigen Aufenthalts dort im Sommer 1912 gefertigt hat. Sie sollen
abschließend die immer noch offene Frage klären helfen, wodurch die Wende in
der künstlerischen Entwicklung Duchamps initiiert wurde, die zum Großen Glas führte. Soweit der Anspruch dieser
Ausstellung. Schwer für den Laien zu vermitteln – wie Duchamps Arbeit überhaupt
– weshalb die meisten der wenigen Besucher die feuilletonistische Aufbereitung
des Bayrischen Rundfunks eine dreiviertel Stunde lang auf einer
Projektionsleinwand verfolgen. Gut dagegen die Idee, neun themenorientierte Begleithefte
mit bebilderten Kurztexten auszulegen. In beiden Darbietungen sind die
Informationen allerdings durchsetzt mit spekulativen Darstellungen der
Katalogautoren. Was für die Katalogbeiträge hinnehmbare, wenn auch postulative
Meinung ist, will in den Heften beeinflussen und lenken. Leider ist auch der
Ausstellungsraum selbst wenig einladend gestaltet. Das heruntergedimmte Licht
in einem dunkelgrau gestrichenen unterirdischen Raum verbreitet
Mausoleumsatmosphäre, die Duchamp zu ironischen Kommentaren herausgefordert
hätte. Oder befinden wir uns im Versammlungsraum einer Geheimgesellschaft von
Duchampexegeten?
Die Münchener
Arbeiten werden ergänzt durch den „Nu
descendant un escalier“, der zweiten Version vom Frühjahr 1912. Dies
Bild erregte später in der Ausstellung in der Armory Show 1913 in New York viel
Aufmerksamkeit und machte Duchamp in den USA bekannt. Zuvor eingereicht zum Salon des Indépendants 1912 in Paris, wurde es jedoch von seinen Malerfreunden um Gleizes, Metzinger
und seinen Brüdern abgelehnt, da es deren kubistischen Auffassungen widersprach.
Duchamp wurde veranlasst, es zurückzuziehen oder zumindest den Titel zu ändern.
Dieser Streit führte schließlich dazu, dass sich Duchamp verärgert von dieser
Gruppe trennte und seine Reise nach München unternahm, wohin ihn sein deutscher
Malerfreund Max Bergmann während seines Parisbesuchs eingeladen hatte. Damit
ist mit diesem letzten Bild der eher eklektischen kubistischen Schaffensphase
der prominente Ausgangspunkt für die nachfolgenden Arbeiten der Münchener Zeit gesetzt.
Am anderen Ende
der Münchener Arbeiten steht das Große
Glas „La mariée mise à nu par ses célibataires, même“, hier in der
Replik von Richard Hamilton, die er 1966 für die Duchamp-Retrospektive in der
Tate Gallery schuf. Leider ist die Aufstellung in der Münchener Ausstellung
misslungen, geradezu kontraproduktiv. Das Glasbild, das von seiner Transparenz
lebt, sollte mitten im Ausstellungsraum freistehen, befindet sich aber nur zwei
Meter vor die dunkelgrau gestrichene Wand gerückt, womit es den Effekt eines
opaken Bildes bekommt. Die Rückseite des Bildes ist durch falsche Lichtführung verschattet
und nicht hinreichend sichtbar. Dabei sind Duchamps Absichten mit dem in
Philadelphia von ihm selbst eingerichteten Original vorgegeben. Auch die
Aufstellung der zweiten Replik (von Ulf Linde gefertigt) in Stockholm trägt dem
Rechnung. Sie steht dort mitten im Ausstellungsraum und gibt den Blick durch
das Glas hindurch und durch ein großes Fenster nach draußen frei. Weiterhin
zeigt man die drei „Schachteln“ und die „Box in a valise“ (Schweriner Landesmuseum, außer
Schachtel v. 1914 vom Centre Pompidou, Paris). Ein abstraktes Bild von Kandinsky soll wohl
das künstlerische Umfeld repräsentieren; ein aufgeschnittener Automotor
(Ausstellungsstück aus dem Deutschen Museum München) sucht dem Besucher die
Herkunft der mechanomorphen Elemente in den fraglichen Zeichnungen Duchamps plausibel
zu machen und mit Max Bergmanns Ölbild mit Kühen wird die andere Seite des
künstlerischen Umfeldes gezeigt. Aus dem privaten Fundus Bergmanns zeigt man
außerdem das von Duchamp geschenkte Bilboquetspiel, ein Tagebuch und einige private
Fotos. Die Fotos zeigen Bergmann mit zwei Nacktmodellen und bedauerlicherweise
nicht Duchamp, womit wir beim lustigen Künstlerleben angelangt wären. Der
nackte Duchamp erscheint dann aber doch noch auf der von ihm 1967 angefertigten
Radierung nach einem Foto von Man Ray, das ihn mit einer Frau zusammen nackt
als „tableau vivant“ nach Lucas Cranach d. Ä. „Adam und Eva“ zeigt. Für das Theaterstück „Relâche“ von Picabia wurde
dies als Pausenfüller, wie der Film „Entr’acte“ von R. Clair, aufgeführt .
Eine dieser
Varianten des „Adam und Eva“ Motivs von Cranach hatte Duchamp in der Münchener
Alten Pinakothek gesehen und war von der Malweise Cranachs sehr beeindruckt,
wie schon Lebel in seiner Monographie von 1959 (dt.1962) feststellte. Lebel bemerkte außerdem, dass
Duchamp die Farben in „Passage de la Vierge à la Mariée“ und „Mariée“ z.T. mit
dem Fingern aufgetragen und verstrichen hatte, um die altmeisterliche glatte
Lasurmalerei nachzuahmen. Duchamps Interesse bezog sich aber nicht nur auf die
Techniken dieser Malerei, die in der Sammlung reich vertreten ist, sondern findet
ihre inhaltlichen Bezugnahmen entscheidend: „In der Tat war alle Malerei bis in
die letzten hundert Jahre literarisch oder religiös: sie ist in den Dienst des
Geistes gestellt worden.“ (James J. Sweeney, Eleven Europeans in America The Museum
of Modern Art Bulletin, NY, XIII, 1946, auch in: M. Sanouiilet u. E. Peterson, Ed.,
The essential writings of Marcel Duchamp, London 1975, S.125 (eigene
Übersetzung)
Im Katalog
versucht nun Michael Taylor das „Adam und Eva“–Motiv in die Generalhypothese
dieser Ausstellung einzupassen. Diese wird im Nachweis eines gedanklichen und
ikonographischen Zusammenhanges der Münchener Arbeiten mit persönlichen
Liebesgeschichten, Erotomanien und Machismo gesucht. Daher wird bei ihm aus der
Fingermalerei, mit der Duchamp ja einen bestimmten Zweck verfolgte, eine
„infantile Geste, die sich als Rückfall in die Unschuld der Kindheit deuten
lässt“. „Dieser sinnenfreudige Einsatz von Ölfarbe ist zweifellos erotisch
konnotiert, insbesondere angesichts des sexuell aufgeladenen Sujets der
Arbeit,…“ (S.59) Derartige Kapriolen vorweg, wird für Taylor die „Eva“ Cranachs
zur „femme fatale“ und demzufolge glaubt er, entwickelte Duchamp mit „Mariée“
als „biomechanischer Braut“ eine zeitgeistige Adaption dieses Themas in seinem Großen Glas. Taylor breitet sein kunsthistorisches
Wissen über „Adam und Eva“ und Cranach aus, um dann die Frage, warum sich
Duchamp auf „Adam und Eva“ bezog und nicht etwa auf die „Mona Lisa“, damit zu
beantworten, er habe seinerzeit eine Beziehung mit Mary Reynolds gehabt. Und er
zitiert deren Exliebhaber, „Reynolds (sei) von ‚merkwürdiger Figur’, mit geschmeidigen
kräftigen Waden, einem eingefallenen Bauch und kleinen Brüsten, einem langen
Hals und einem scharf geschnittenen und doch sanften Vogelgesicht; sie sei von
einem auf anmutige Weise misslichen Äußeren, wie ein Mädchen in einem Bild von
Cranach’.“ (S.65) Dass Duchamp von Cranachs Frauengestalten so beeindruckt war,
dass er seine langjährige Lebenspartnerin entsprechend auswählte, war mir neu
und kann als bahnbrechende Erkenntnis der sogenannten Duchampforschung gelten! Schließlich
bezieht Taylor die „Adam und Eva“ Geschichte auf Duchamps letztes Werk „Étant
donnés“, was ich hier nicht weiterverfolgen möchte.
Mit einer mechanomorphen Ikonographie, die
übrigens stark beeinflusst ist von Picabia, versucht Duchamp formale Gefüge darzustellen,
wie die ausgestellten Zeichnungen zeigen. Technische Neuerungen wie
Nähmaschinen, Automobile und Fluggeräte inspirieren und erneuern seine künstlerischen
Ausdruckmittel. Es wäre jedoch irrig anzunehmen, ein Künstler erarbeite diese,
um dem technikbegeisterten Zeitgeist und
den unglücklichen Liebesgeschichten eine bildnerische Entsprechung zu
verleihen. Das befände sich auf dem Niveau von Kubismus und Empfindungsmalerei.
Taylor verfolgt jedoch diesen Weg, den schon andere vor ihm gegangen sind, denn
der Besucher soll offenbar auf diese, dem Anekdotischen verpflichtete
Rezeptionsabsicht hingeführt werden. Die Leitidee aller Katalogbeiträge stellt
sich leider in diese lange Tradition der Duchampexegese und man sieht daran,
wie nachhaltig auch in der Kunst akademische Lehrmeinungen den Blick verstellen
für eine unvoreingenommene Prüfung der künstlerischen Arbeit. Die Auswirkungen
sind beträchtlich.
Aus den
ausgestellten Münchener Arbeiten lässt sich gut ablesen, wie Elemente aus den
beiden Zeichnungen der „Vierge“
im Ölbild „Le passage de la vierge à
la mariée“ und weiterverarbeitet im zweiten Ölbild „Mariée“ auftauchen und von dort ganze
Bildteile übertragen wurden in den oberen Teil des Glasbildes. Es handelt sich
um die „Mariée“ oder den
sogenannten „Weiblichen Gehenkten“, da dieses anthropomorphe Gebilde an einem
(gemalten) Haken am oberen Rand des Glasbildes aufgehängt scheint. Warum das so
ist, erscheint nicht in den Analysen des Katalogs, und was das Gebilde
darstellen soll, wird nicht hinterfragt. Bei Molderings wird der Übergang von
der „Vierge“ (Jungfrau) zur „Mariée“ (Braut) sexuell konnotiert,
unterlegt mit Hinweisen darauf, dass die Braut früher ihre Aussteuer selbst
nähen musste, nun mit der Nähmaschine. Auch wenn Molderings behauptet, die
Zeichnung von „Vierge N°1“ stelle den Kopf einer Nähmaschine dar, so ist diese
Interpretation soviel wert wie Linda D. Hendersons Behauptung, diese Zeichnung
stelle um 90° gekippt den Schnitt durch die Antriebsaggregate eines
Renault-Automobils von 1902 dar. (Linda D. Henderson, Duchamp in context,
Princeton, NY, 1998, S.89f, fig. 50,51) Dieser Ansatz ist sogar plausibler, da
Duchamp in der Grünen Schachtel in seiner zehnseitigen Notiz zur Braut angibt,
in zwei Münchener Zeichnungen den „arbre-type“ (Kardanwelle) dargestellt zu
haben – und es kommen nur die beiden „Vierge“ Fassungen in Betracht. Was also
ist gewonnen? Die Beschreibung der „Mariée“ und der „Celibataires“ in der
langen Notiz der Grünen Schachtel stellt eine Mixtur aus dem Jargon der
Automobiltechnik und erotischer Anspielungen dar. Auf der populären Ebene
findet sich bis heute diese Mixtur in jedem Katalog von Automobilsalons. Stattdessen
sollte man die Zeichnungen und die folgenden Ölgemälde auf ihren metaphorischen
Gehalt einer in ihr enthaltenen Idee der Transformation (Jungfrau ® Braut) untersuchen. Dazu
würde es sich lohnen, „Die Transformatoren Duchamp“ von Jean-Francois Lyotard
wieder in die Hand zu nehmen.
Komplizierter
ist die Entschlüsselung der Zeichnung mit dem Titel „Première recherche pour: La
mariée mise à nu par les célibataires“. Dieser Titel gibt zum ersten
Mal den Titel des Großen Glases vor, verändert heißt es dort „ses“ statt „les“
und „même“ beendet die Phrase. Übersetzen lässt sich dieser Titel mit „Die
Braut entblößt durch die Junggesellen“, wobei das „mise à nu“ noch andere
Bedeutungen enthält als „entblößt“, nämlich „offengelegt“, „offenbar gemacht“.
Was also macht diese Zeichnung offenbar? Die zusätzlichen Anmerkungen
„Mechanismus der Schamhaftigkeit/Schammaschine“ geben einen Hinweis auf die
„schamhafte Kraft“ (puissance timide),
von der in der langen Notiz zur Braut in der Grünen Schachtel die Rede ist.
Offensichtlich wird die gesamte Transformation durch einen Motor angetrieben,
der mit gebremster Kraft arbeitet. Aber es führt zu weit, wollte man die in
Duchamps Text angelegten Erläuterungen hier darlegen. Das erfordert
grundlegendes Vorgehen mit völlig anderer Hypothese. Diese Zeichnung ist jedoch
einer der Schlüssel zur Ausdeutung des Großen
Glases. Anstatt nun aber den diagrammatischen Ansatz dieser Zeichnung zu
untersuchen, überträgt Molderings sehr mechanisch und gar nicht schamhaft das
Gemälde „Die Rivalen“ von Adolf Münzer aus der Gewerbeschau von 1912 auf diese
Zeichnung. Diese behauptete Vorlage stellt zwei männliche Gestalten dar, die mit
Dolchen und Degen bewaffnet eine zwischen ihnen auf einer Blumengirlande
sitzende Frau bedrängen. Bereits in dem Aufsatz von Ulf Linde von 1977 („L’ésotérique“, Katalog Marcel
Duchamp, Centre Pompidou, Paris 1977, S.60ff) wurde diese Interpretation
eingeführt, wenn auch anhand anderer Bildbeispiele. Molderings und auch
Franklins Auslegung glaubt den heimlichen Kampf Duchamps um Picabias Frau
Gabrielle darin widergespiegelt. Ähnlich argumentiert Michael Taylor, wenn er
in seinem Katalogbeitrag „Beschämung und Verwundbarkeit in dieser bedrohlichen
sexuellen Begegnung“ (S.57) ausmacht. Denkt er an Vergewaltigung? Ich möchte
mir derartige Banalitäten als Gegenstand der Kunst lieber nicht vorstellen. Da
ist Linda D. Henderson Deutung dieser Zeichnung, wenn sie Märchenhaftes aus dem
Wunderland der Technik mit alchemistischen Spekulationen verbindet,
unterhaltsamer, wenn auch nicht immer einleuchtender. (Linda D. Henderson, Duchamp
in context, Princeton, NY, 1998, S.25)
So liest sich
der Beitrag Molderings im ganzen wie ein Erlebnisbericht aus einer Zeit, in die
sich peinlicherweise der Autor hineinversetzt, um aus einem Zeitgefühl heraus
den Absichten seines Protagonisten näher zu kommen. Die Aufhebung der kritischen Distanz
verleitet Molderings zu plakativen Schlussfolgerungen, wie der, Duchamp sei ein
Frauenheld gewesen. Und wie zum Beweis sei Duchamp, nach Angaben der Frau
seines Freundes Picabia, Gabrielle Picabia, unsterblich in sie verliebt
gewesen, und habe, um sie zu treffen eine vierzehnstündige Zugfahrt von München
in den Jura unternommen. Mag sein, aber was soll das für die Kunst bedeuten?
Auch Peggy Guggenheim behauptete in ihrer Autobiographie nach ihrer Trennung
von Max Ernst eine Affäre mit Duchamp, die es aber nie gegeben hat. Scheinbar
plausibel für den Konsumenten von Homestorys entwertet dieses Vorgehen ein
ernsthaftes Verständnis des Duchampschen Kunstbegriffs, denn zum
Kunstverständnis Duchamps trägt eine solche Vermutung, sei sie auch richtig,
überhaupt nichts bei. Da ist der Wunsch Vater des Gedankens, denn wer je mit
Künstlern zu tun hatte, weiß, dass zwischen der Party und dem Atelier eine Welt
liegt. In dieselbe Richtung ermittelt Thomas Girst, der das Bilboquet eindeutig
sexuell konnotiert sieht, denn immerhin muß der Stab in die Kugel gesteckt
werden! Die Welt ist voller Dinge, die zusammengesteckt werden, eine Orgie. Und
in der Zeichnung „Umarmung“ findet er bei einem tanzenden Paar den Frauenkörper
als phallische Verlängerung des männlichen, von dem behauptet wird, er stelle
Duchamp dar. Es müsste schon eine Selbstdarstellung sein, denn Duchamp selbst
hat sie mit wenigen Strichen von hinten angedeutet gezeichnet. Für Girst ist
Beweis genug, dass er einen Hut trägt, der ähnlich dem ist, den Duchamp auf
einer Porträtskizze Bergmanns trägt. War Girst damals in Paris dabei?
Statt
vorgeblicher Quellentreue stellt sich der Eindruck von Hilflosigkeit der
Interpretation ein. Dafür ist Erotismus ein elastischer Ersatz. Aber genau
damit spielt Duchamp! Wenn man Duchamp für einen intelligenten und eher
scharfsichtigen Beobachter hält, wird man kaum auf die Idee kommen, ihn als
tumbes Opfer von Sex- und Automobilbesessenheit zu etikettieren, sondern viel
eher als jemanden einzuschätzen haben, der bewusst seine wahren Absichten durch
solche Metaphorik zu tarnen wusste. Nicht umsonst betont er Ironie als
strategisches Mittel und bezeichnet sein Großes
Glas als „tableau hilarant“
(Lachbild).
Es wird also ein
autobiographisches Element als Triebfeder des Duchampschen Werks beteuert. Molderings
Fazit im Katalog lautet: „Je mehr sich Duchamps Bildphantasie bei der
Ausarbeitung der einzelnen Elemente dieses Gemäldes aus dem sexuellen Unbewußten
speiste, desto stärker griff er fortan zu deren Darstellung auf möglichst
unpersönliche, technische Bildverfahren zurück, …“ (S.33) Diese behauptete
Kausalität zeigt die Hilflosigkeit als rhetorisches Blendwerk und dieser Ansatz
ist weder neu noch reicht er zur Rechtfertigung dieser Ausstellung. Schon
Thierry de Duve hat 1984 mit seinem „Nominalisme pictural“ versucht die
psychologisch-biographisch gefärbten Ideen eines Michel Carrouges oder Arturo
Schwartz erneut aufzubereiten. Schwartz ging immerhin so weit, Inzestbeziehungen
zu vermuten, während Carrouges das Konzept der „Junggesellenmaschine“ 1954
geprägt hat und wesentlich H. Szeemanns Ausstellungsprojekt gleichen Titels von
1975 bestimmte. Über diese Ideen Carrouges’ hat sich Duchamp zu Lebzeiten noch
lustig gemacht, als er Breton am 4.10.1954 schrieb:
„’Junggesellenmaschine’ soweit es „La Mariée…“ betrifft,
bezeichnet eine Menge an Operationen und hat für mich keine andere Bedeutung
als eines partiellen und beschreibenden Titels und nicht eines absichtsvoll
mystischen Themas. … Unter Zuhilfenahme der grünen Schachtel hat Carrouges mit
aller Gründlichkeit durch Sezieren des Unterbewußten einen verborgenen Ablauf
zutage gefördert. Unnötig anzumerken, dass seine Entdeckungen, wenn sie ein
kohärentes Ganzes ergäben, nie in meiner Ausarbeitung bewusst geworden
wären, weil mein Unterbewusstsein stumm ist wie jedes Unterbewusstsein; und
dass die Ausarbeitung weit mehr die bewusste Notwendigkeit von
‚Heiterkeit’ oder zumindest von Humor in einer so ‚ernsten’ Angelegenheit
betraf.“ (Affectionately, Marcel, Hg F.Naumann u. H.Obalk, Ghent 2000, Brief N°
235; Übersetzung a. d. franz. v. Verf.)
So könnte man heute
auch Molderings antworten. Warum sollte ein Künstler acht Jahre lang an einer
eher pubertär anmutenden Erotomanie arbeiten und dafür erfindungsreich nicht
nur eine ungewöhnliche Ikonographie entwickeln, sondern auch noch eine
innovative Technik, wie sie in der spezifischen Bearbeitung von Glas erforderlich
wurde? Das scheint mir überhaupt nicht plausibel. Die vereinten Bemühungen der
kunstwissenschaftlichen Interpreten scheint dermaßen an den von Duchamp
ausgelegten Leimruten zu haften, dass hier die notwendige Phantasie und der
nötige Abstand verlorengegangen sind.
„In der Tat war alle Malerei bis in die letzten hundert Jahre
literarisch oder religiös: sie ist in den Dienst des Geistes gestellt worden.
Dieses Charakteristikum ist im vergangenen Jahrhundert nach und nach
verschwunden. Je stärker ein Gemälde an die Sinne appellierte – je tierischer
es wurde – desto höher wurde es eingeschätzt.“ Und wenige Zeilen weiter: „Dies
ist die Richtung, die die Kunst einschlagen sollte: hin zu einem
intellektuellen Ausdruck eher als zu einem tierischen Ausdruck. Ich bin
angewidert von der Bezeichnung „dumm wie ein Maler.“ (Gespräch mit James J.
Sweeney, Duchamp du signe, ed. M. Sanouiilet, Paris 1975, S.172 u. 174 (eigene
Übersetzung; s.a.Stauffer, , a.a.O., S.37 u. 38)
Will man nun
also sexuelle Phantasien, die doch wohl eher „tierisch“ sind, zum Inhalt der von
Duchamp propagierten neuen Kunst „im Dienste des Geistes“ machen? Ist dies die „Entdeckung
geistigen Sehens“, wie Molderings seinen Katalogbeitrag betitelt?
Womit
beschäftigt sich ein Künstler?, möchte man die versammelten Duchampspezialisten
fragen. Um das entsprechende Bild vom Künstler zu propagieren, zeigt man ein paar
Fotos mit nackten Modellen. Der Künstler bei der Arbeit? Oder doch eher eine
vergnügliche Arbeitspause. Sind es die in der Biografie aufgestöberten
Liebschaften und die wüsten Gelage, wie später bei Arensberg in New York, die
das Material der Künstler sind? Das scheinen mir eher kleinbürgerliche
Phantasien zu sein und nicht vom Interesse getragen an der Ernsthaftigkeit künstlerischer
Arbeit. Ginge es in der Kunst Duchamps um sexuelle Frustration, erotomanische
Phantasie und Machogehabe, dann könnten wir getrost auf diese Kunst verzichten,
denn derber und dümmer sind nicht einmal die Maler. In der Duchampexegese ist
jedenfalls die Phantasie gefragt, die Duchamp hatte, und die nach wie vor
seinen Exegeten fehlt!
Die Methode
vieler Kunstwissenschaftler die künstlerische Arbeit als Durcharbeiten biographischer Anlässe
aufzufassen, stößt bei Künstlern generell auf Verachtung. Der künstlerischen
Arbeit wird der Eigenanspruch genommen, ja, sie erscheint geradezu lächerlich
als Betroffenheitslyrik und der Kunstbegriff wird einer laienpsychologischen
Untersuchung unterzogen. Während dies Vorgehen plakativ erscheint, wird es bei
Taylor zusätzlich problematisch, denn er funktionalisiert die Kunstgeschichte
in passender Ideologie. Er macht sie zum „Prellbock“ („butoir“ – ein Ausdruck Duchamps) der
künstlerischen Absichten Duchamps, indem er Cranachs Kunst selbst auf
verborgene erotische Anspielungen hin bearbeitet. So wird aus der
Kunstgeschichte heraus eine bestimmte Interpretation gerettet, die auf Duchamps
Kunst übertragen, diese entschärft. Da bleibt dann nichts mehr vom „Bewusstsein
der Gegenwart, welches das Kontinuum der Geschichte aufsprengt“, wie Benjamin
in dem von Taylor zitierten Aufsatz über die Methode des historischen
Materialismus sagt. (Walter Benjamin, Gesammelte Schriften Bd. II,2,
Frankfurt/M 1977, S.468) Ins Gegenteil gekehrt interessiert Taylor nur das
„Nachleben des Verstandenen“, weil es für ihn die Kontinuität rettet; der
historische Materialismus ist nicht seine Sache.
Duchamp, der
mit dem Bewusstsein der Gegenwart die Kunstgeschichte aufsprengt, wird in der
Kunstgeschichte entsorgt und damit geschieht genau das, was Duchamp als das
drohende Schicksal jeder künstlerischen Arbeit ausgemacht hatte: Das Verdikt
der Nachwelt, das sich alle 50 Jahre ändert, im Gewand des Geschmacks und der
Ideologie. Von vielen ist dieser Sachverhalt kritisiert worden. Diese Ausstellung
sucht keine kritische Distanz, sondern die Versöhnung der Kunstgeschichte mit
Duchamp. Ein Satz von Paul Valéry mag hier für alle anderen stehen: „Das Leben
des Autors ist nicht das Leben des Menschen, der er ist.“ (Paul Valéry:
Anmerkung und Abschweifung, in: Paul Valéry Werke, Bd.6, Frankfurt/Leipzig
1995, S.98)
Laufzeit der Ausstellung 31.3.-15.7.2012
Laufzeit der Ausstellung 31.3.-15.7.2012

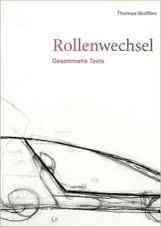

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen