Biennale handgemacht
4. April 2008 / Eingestellt von thw um 20:21 /
"So viel Nostalgie war nie. Aber die fünfte Berlin Biennale hat wohl anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ein Recht, mehr retrospektiv zu sein als der Zukunft zugewandt. Leider verpasst sie mit diesem Ansinnen die Zukunft, wenn nicht sogar die Gegenwart. Aber mit dem Titel ‚When things cast no shadow’ (Wenn Dinge keinen Schatten werfen) übt man sich in Bescheidenheit oder kokettiert mit dieser. Schon der Ausstellungsort Nationalgalerie im sogenannten Kulturforum ist ein Beweis für die Bedeutung der Berlin Biennale im internationalen Festivalreigen der zeitgenössischen Kunst. Die jetzigen Kuratoren Adam Szymczyk , Direktor der Kunsthalle Basel, und Elena Filipovic, freie Kuratorin aus New York, haben einen guten Ruf innerhalb der Szene, aber besitzen nicht den Glamour von Mauricio Cattelan, Missimiliano Gioni und Ali Subotnik, die die vorher gehende Biennale zu einem großen Erfolg machten. Diese neue Biennale aber zeitigt schon jetzt kontroverse Reaktionen. Das liegt weniger an den Orten, die geschickt gewählt sind, als an den Objekten. Das ist sehr vieles von Hand gemacht und vermittelt dem Besucher das seltsam wohlige Gefühl, in einer anderen Zeit zu sein. Schon Paola Pivis gigantisches Glitzer-Gitter am Eingang der Nationalgalerie wirkt eher irritierend als überzeugend. Auch die nachgearbeiteten Möbel-Ikonen von Thea Djordjadze haben die Patina einer vergangenen Zeit. Es ist und bleibt erstaunlich, wie die Moderne immer noch als Steinbruch für die Gegenwart dienen kann. Die Stichworte einer zweiten Moderne oder einer digitalen Zukunft kennt diese Biennale nicht, genauso wenig wie den Modernisierungsschub durch die Studentengeneration von 1968. Oder sollten wir die geballte Faust von Piotr Uklanski vor der Nationalgalerie als einen Hinweis darauf lesen?
Mit dem Plan in der Hand lässt sich dann auch jede einzelne Arbeit identifizieren, weil man im Mies van der Rohe Bau auf Schilder verzichtet hat. Das hat einen gewissen Reiz, vor allem auch weil die Arbeiten sich scheinbar zum Teil überlagern zu scheinen. Leider hat man allerdings auch darauf verzichtet, sich in die Sammlung der Nationalgalerie selbst auf irgendeine Weise einzuklinken. Soviel Moderne oder Postmoderne wollte man dann doch nicht riskieren. So aber spielen die Kinder für sich in der großen Halle und die Erwachsenen schleichen in das Untergeschoss.
Im Stammhaus der Berlin Biennale, den KW Institute for Contemporary Art, früher einfach nur 'Kunstwerke', in der Auguststraße, wird der Besucher von der scheinbar leeren Ausstellungshalle bis unter das Dach durch eine Ausstellungsarchitektur umfangen, die schon fast zu perfekt erscheint. Wer damit nicht zu Recht kommt, der kann auf ein kleines Büchlein zurückgreifen, in dem jede einzelne Arbeit kurz erklärt wird. Die ‚leere’ Ausstellungshalle ist dabei eine Arbeit von Ahmet Ögüt, der den Boden auf vierhundert Quadratmetern mit Asphalt ausstatten ließ. Darüber hinaus bietet dieser Ausstellungsbereich dann auch insgesamt sieben Filmprojektionen an, denen man sich dann aussetzen kann. Angeraten ist dies allerdings nur in der Woche, weil dann der Besucherstrom geringer ausfällt und der Blick auf die Leinwand nicht gestört wird. Auf einer Landbrache inmitten der Stadt findet sich der dritte Ausstellungsort, bis dahin geschickt bespielt von einer Künstlerinitiative. Der sogenannte Skulpturenpark an der Schnittkante von Mitte und Kreuzberg wird zum Teil von Künstlern bespielt, die schon an den anderen Orten präsent sind wie Pedro Barateiro, der hier ein sozialistisches Gegenstück zu seiner modernistischen Bushaltestelle vor der Nationalgalerie hingestellt hat nebst Broschüre zur Bedeutung.
Zugegebenermaßen fehlen in der Künstlerliste die üblichen Verdächtigen. Das fällt einem angenehm auf. Aber anderseits ist dann auch zu erfahren, dass die wichtigen Galerien wie Buchholz aus Köln oder Neu aus Berlin schon einige dieser Künstler vertreten. So mag die Ausstellung zwar altmodisch anmuten, aber die Künstler und Künstlerinnen sind die Zukunft. Vielleicht deshalb braucht diese Biennale auch ein Abendprogramm, um diese Zukunft zu verdeutlichen. Unter dem Titel ‚Meine Nächste sind schöner als deine Tage’ wird hier jene Diskursivität gefördert, die man in den ausgestellten Arbeiten zum Teil noch angestrengt suchen muss. Diesem Teil wird dann auch tatsächlich noch mal ein Büchlein gewidmet. Aber mit einem Budget von 3 Millionen Euro lässt sich auch das bewerkstelligen. Nicht zu vergessen ist auch der vierte Ausstellungsraum, der sogenannte Schinkel-Pavillon, der schon seine Eröffnung vor der eigentlichen Eröffnung feiern konnte. Hier zeigen junge Künstler die Vorbilder der Alten und heißen sie auch Ettore Sottsass. So viel Zukunft muss schon sein in der Vergangenheit."
Thomas Wulffen
Der Text erscheint morgen in den 'Stuttgarter Nachrichten'.

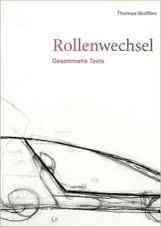

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen